<p>In Stuttgart bestand eine kleine jüdische Gemeinde zunächst im Mittelalter: 1343 wird der Jude Loew genannt, der unter Graf Ulrich III. eine bedeutende Stellung einnahm. Die Judenverfolgung während der Pestzeit vernichtete im November 1348 die kleine Gemeinde. Einige Jahrzehnte später (seit 1393) werden wieder Juden in der Stadt genannt, die nun in der St.-Leonhards-Vorstadt ansässig waren. 1488/98 wurden die Stuttgarter Juden ausgewiesen. Seit Ende des 14. Jahrhunderts war die jüdische Ansiedlung in der heutigen Brennerstrasse. Es sind keine Spuren dieser mittelalterlichen Gemeinde mehr erhalten.</p><p>Unter Herzog Friedrich I. wurden 1598 jüdische Kaufleute der Firma Gabrieli & Co. in Stuttgart aufgenommen. Trotz des Einspruches der Landstände und des Hofpredigers wurden Gabrieli und sieben Genossen in Stuttgart aufgenommen. Als sie einen Betsaal einrichteten, entstand jedoch eine große Erregung, sodass sich der Herzog entschloss, Gabrieli den Ort Neidlingen als Wohnort zuzuweisen. Dort war das Unternehmen nicht lebensfähig, Gabrieli und Genossen zogen nach drei Monaten wieder ab und ließen sich mit besserem Erfolg in Lothringen nieder.</p><p>Die Entstehung der neuzeitlichen Gemeinde Stuttgart geht in die Zeit Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Wie an fast allen Fürstenhöfen Europas hatten auch in Stuttgart sogenannte Hofjuden und Hoffaktoren eine Anstellung gefunden. 1832 konnte eine neue Gemeinde gegründet werden, die im Laufe der folgenden Jahrzehnte eine stürmische Entwicklung nahm. Bis 1925/33 sollte die Zahl der jüdischen Einwohner Stuttgarts auf ca. 4.500 Personen anwachsen, um danach zunächst langsam und infolge der 1933 erfolgten Machtübernahme durch die Nationalsozialisten immer schneller zurückzugehen. </p><p>Nach der Befreiung entstanden in Stuttgart zwei Lager mit Überlebenden der Shoah (sog. Displaced Persons - DP) in der Reinsburgstraße und in Stuttgart-Degerloch, um sie dort zu versorgen und vor erneuten Übergriffen zu schützen. Diese DPs waren es auch im Wesentlichen, die die jüdische Gemeinde in Stuttgart und Württemberg nach 1945 wieder aufbauten. So fand bereits Anfang Juni 1945 - kaum mehr als einen Monat nach der Befreiung Stuttgarts und 25 Tage nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands - in der Reinsburgstraße wieder ein jüdischer Gottesdienst in einem improvisierten Gebetsraum in der Reinsburgstraße 26 statt. Geleitet wurde er von Militärrabbiner Herbert S. Eskin, der die jüdischen Überlebenden der Shoah (hebr. für Katastrophe) unter seine Fittiche nahm. Er ermutigte diese ebenfalls wieder eine jüdische Gemeinde - die Israelitische Kultusvereinigung Württembergs (IKVW), später Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) - zu gründen. Obgleich nur sehr wenige der Stuttgarter und Württemberger Juden, die die Shoah im Exil überlebt haben, je zurückgekehrt sind, wurde die Gemeinde dank dem Zuspruch von Rabbiner Eskin bereits am 9. Juni 1945 wiedergegründet. Die Neue Stuttgarter Synagoge - der erste Synagogenneubau in der jungen Bundesrepublik aus dem Jahr 1952 - befindet sich am Ort der ehemaligen und in den Pogromen im November 1938 zerstörten Synagoge.<br /><br />Mit dem Beginn der jüdischen Zuwanderung aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion 1992 erlebte die IRGW einen deutlichen Schub und heute ist die Stuttgarter Ortsgemeinde der IRGW die mit Abstand größte jüdische Gemeinde in Baden-Württemberg, mit Synagoge, Mikwe (Ritualbad), Kindergarten, Grundschule und Jugendzentrum, sowie einem betreuten Seniorenwohnen für die älteren Mitglieder der Gemeinde.</p><p> </p>








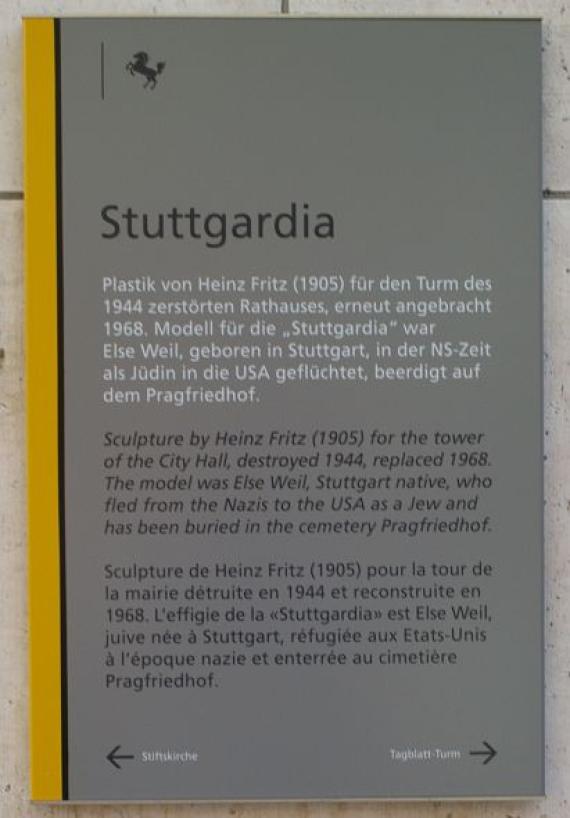


Neuen Kommentar hinzufügen